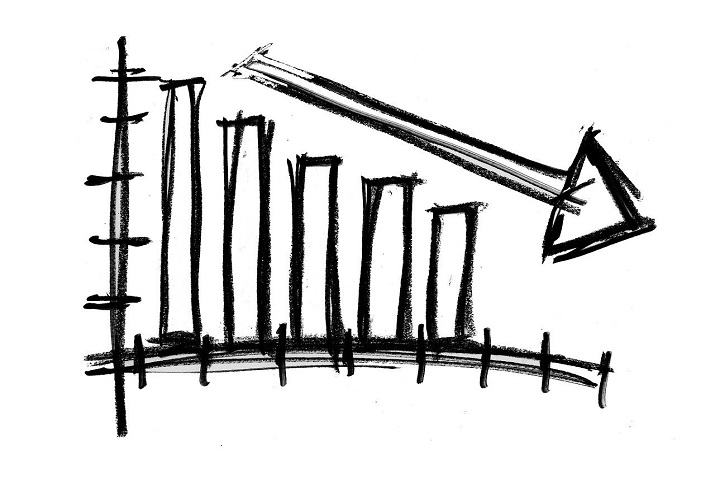Seit fast einem Jahr haben Warnungen vor Krisen und Diagnosen eingetretener Krisen nicht nur in Deutschland Hochkonjunktur. Das Coronavirus SARS-CoV-2 löste neben Sorgen vor den gesundheitlichen Folgen einer Infektion zahlreiche weitergehende Befürchtungen aus. Bereits vom Frühjahr 2020 an bezogen sie sich auf die sozialen Auswirkungen von Infektionsschutzmaßnahmen und alsbald genauso auf deren ökonomische Folgen. Ein potenziell tödliches Virus erweckte das Gespenst einer drohenden ‚Wirtschaftskrise‘[1] zu neuem Leben.
Spätestens seit dem Entstehen moderner Mediengesellschaften sind ‚Krisen‘ ein stetig wiederkehrendes Phänomen. Von ‚Wirtschaftskrisen‘ zu reden bürgerte sich im deutschsprachigen Raum im 19. Jahrhundert ein.[2] Viel spricht dafür, dass sich der Rhythmus, in dem sie auftreten, im Verlauf des 20. Jahrhunderts beschleunigt hat.[3] In der politischen Kommunikation fungieren ‚Krisen‘ als machtvolles Deutungsmuster, mit dem Zeitgenoss*innen Unsicherheiten, Herausforderungen und Problemlagen ihrer Gegenwart oder unmittelbaren Zukunft auf den Begriff bringen. Sobald sich die Deutung, eine ‚Krise‘ sei eingetreten, in der politisch-medialen Kommunikation durchsetzt, wird sie äußerst wirkmächtig: In kürzester Zeit stiftet sie neue Sachzwänge, löst Handlungsdruck aus, verschiebt die Hierarchie politischer Probleme und verändert Vorstellungen von angemessenem politischen Agieren. Auf diese Weise machen ‚Krisen‘ Politik – oder präziser: auf diese Weise wird mit ‚Krisen‘ Politik gemacht.
Als Kommunikationsphänomen folgen ‚Krisen‘ bestimmten Mustern. Das gilt für ‚Krisen‘ im Allgemeinen wie für ‚Wirtschaftskrisen‘ im Speziellen.[4] Derartige Muster offenzulegen bewirkt zweierlei: Typische Krisenverläufe werden durchschaubarer, und Spezifika der einzelnen Krisen treten markanter hervor. Wenn sich Historiker*innen nun auf das Terrain der Gegenwartsanalyse wagen, lautet die Frage:[5] Wie lässt sich aus einer solchen Perspektive das aktuelle Krisengeschehen verstehen? Inwieweit ist die ‚Corona-Krise‘ (k)eine typische ‚(Wirtschafts-)Krise‘? Mit Blick auf die Krisendiskurse in Deutschland geht der Beitrag dieser Frage schlaglichtartig nach.
Wie ‚Krisen‘ beginnen und zu ‚Wirtschaftskrisen‘ werden
Populäre Darstellungen heben oft Einzelereignisse, die sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben, hervor, um an ihnen den Beginn einer Wirtschaftskrise festzumachen. Doch dieser Faden, der sich vom New Yorker Börsencrash am Schwarzen Donnerstag im Oktober 1929 bis zum Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers im September 2008 spinnen lässt, wird Krisen als politischem Kommunikationsphänomen kaum gerecht. ‚Wirtschaftskrisen‘ beginnen selten als solche. Zumeist entwickeln sie sich aus zuvor aufgekommenen, nicht zuvorderst wirtschaftsbezogenen Krisendeutungen heraus oder schließen an diese an. Damit Krisendeutungen überhaupt bestimmend in der politischen Kommunikation werden (salopp: damit ‚Krisen‘ ausbrechen), müssen drei Faktoren zusammenkommen: eine strukturelle Problemlage, mit der sich ein einschneidendes politisches Ereignis verbindet, über das medial intensiv berichtet wird.
In der Endphase der ohnehin krisenreichen Weimarer Republik beispielsweise setzte sich die Deutung einer umfassenden ‚(Wirtschafts-)Krise‘ erst im Sommer 1930 dauerhaft fest, als zu einem Komplex mehrerer struktureller Herausforderungen (Konjunkturrückgang, Kapitalabzug nach dem New Yorker Börsencrash, Haushaltsloch, notleidende Landwirtschaft, Bruch der Großen Koalition unter SPD-Reichskanzler Müller) der in der Presse breit aufgegriffene Streit um die ersten Notverordnungen der Regierung Brüning hinzutrat.
78 Jahre später, im Herbst 2008, war es nicht das Platzen der US-amerikanischen Immobilienblase und die so provozierte Insolvenz von Lehman Brothers, die in der deutschen Öffentlichkeit das Interpretationsmuster ‚Krise‘ verankerte. Als folgenschwer erwies sich vielmehr eine eilig einberufene Pressekonferenz im Bundeskanzleramt am Nachmittag des 5. Oktober 2008, einem Sonntag. Angesichts der ebenfalls konkursbedrohten deutschen Bank Hypo Real Estate versicherten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesfinanzminister Peer Steinbrück sämtlichen Sparer*innen, ihre Guthaben seien sicher und würden notfalls staatlich garantiert. Die ungewöhnliche Szenerie und die außergewöhnliche Message etablierten zügig die Deutung einer ernsten ‚Krise‘. Aus der Rede von einer ‚Banken- und Finanzkrise‘ entwickelte sich alsbald eine ‚(Welt-)Wirtschaftskrise‘.
Der Jahresanfang 2020 fügte sich in dieses Muster passgenau ein. Nicht die ersten Meldungen über ein neuartiges Virus in China am Silvestertag 2019 und genauso wenig die Ausrufung des Internationalen Gesundheitsnotstands durch die Weltgesundheitsorganisation am 30. Januar 2020 führten zum Durchbruch umfassender Krisenbehauptungen im politischen Kommunikationsraum. Sondern steigende Zahlen festgestellter Infektionen mit dem neuen Coronavirus in Deutschland in Kombination mit massenmedial transportierten Bildern überlasteter Krankenhäuser in Norditalien – besonders drastisch in Bergamo – provozierten schlagartig Analogieschlüsse. Sie riefen die Frage hervor, ob und ab wann hierzulande eine ähnliche Situation drohe, und mündeten in die Redeweise von der ‚abzuflachenden Kurve‘ der Neuinfektionen, mit der ein Kollaps des Gesundheitssystems verhindert werden sollte. Dieses Sprachmuster legitimierte argumentativ die Entscheidung für den ersten sogenannten ‚Lockdown‘. Endgültig durch brach die ‚Krise‘, als die Bundeskanzlerin am 18. März abermals zu einem ungewöhnlichen Mittel griff, um diesen Einschnitt ins soziale Leben zu begründen: der einzigen Fernsehansprache ihrer Amtszeit jenseits von Neujahrsansprachen.
Das Redemuster von der ‚nie dagewesenen Situation‘ und die Kontraktion der Sichtweisen
Gleich im zweiten Satz ihrer Ansprache konstatierte die Kanzlerin, „unsere Vorstellung von Normalität […] [werde] auf die Probe gestellt wie nie zuvor.“[6] Zum Schluss mahnte sie: „Wir müssen, auch wenn wir so etwas noch nie erlebt haben, zeigen, dass wir herzlich und vernünftig handeln […].“[7] Merkel griff damit auf einen Topos[8] zurück, der sich für zahlreiche Krisendiskurse als konstitutiv erwiesen hat. Redner*innen und Autor*innen nutzten ihn 1930 zu Beginn der Weltwirtschaftskrise genauso wie in der bundesdeutschen Wachstumskrise 1966/67, der kleinen Weltwirtschaftskrise der 1970er Jahre oder in zahlreichen Wirtschafts- und sozialpolitischen Krisen zwischen 1980 und 2008.[9] Pragmatisch diente ein solches Behaupten der absoluten Neuartigkeit der Situation zum einen dazu, für eine drohende Problem- oder Gefahrenlage zu sensibilisieren. Zum anderen war und ist es speziell für Regierende von Wert, suggeriert es doch, dass es keinen bekannten Maßstab gebe, anhand dessen die Angemessenheit politischer Reaktionen auf die ‚Krise‘ zu beurteilen ist. Das Sprachmuster eröffnet Möglichkeitsräume für politisches Handeln und dämpft Erwartungen.
Damit geht einher, dass sich die Bandbreite möglicher Aussagen zur Art der Probleme und zu politischen Reaktionen am Anfang von ‚Krisen‘ stets drastisch verengt. Hieraus folgt oftmals ein Vorteil für Regierungen, die weniger von ihrer unmittelbaren Handlungsmacht profitieren als davon, dass ihren Einschätzungen und Entscheidungen kaum konkurrierende Sichtweisen und Aussagen entgegengestellt werden können. Plastisch zeigte sich dies etwa im Winter 1966/67, als die neu ins Amt gekommene Große Koalition unter Bundeskanzler Kiesinger binnen weniger Wochen mit breiter öffentlicher Zustimmung einen fulminanten Shift von einer ordoliberalen zu einer keynesianischen Wirtschaftspolitik vollziehen konnte. Genauso erkennbar war dies im November 1973, als der Bundestag direkt nach Ausbruch der Ölpreiskrise ohne Gegenstimme (!) ein „Energiesicherungsgesetz“ verabschiedete, auf dessen Basis den Bundesbürger*innen unter anderem vier autofreie Sonntage verordnet wurden. Dass die Entscheidung zum ersten ‚Lockdown‘ im März 2020 keinen nennenswerten Widerspruch hervorrief – und der Bundesregierung sogar rekordverdächtige Zustimmungswerte bescherte[10] –, erstaunt daher keineswegs. Genauso überrascht es nicht, dass die Regierung auf merklich mehr Unmut stieß und unter größeren Begründungsdruck geriet, als ab Oktober 2020 erneute Einschränkungen beschlossen wurden. Auch das passt ins Muster: Denn sobald eine ‚Krise‘ von einer plötzlich zugespitzten Situation zu einer dauerhafteren Problemlage mutiert, dehnt sich das Spektrum an Positionen und Handlungsvorschlägen aus. Debatten werden pluraler. Schuld- und Verantwortungszuschreibungen nehmen zu. Davon zeugen alle größeren Krisen seit den 1930er Jahren.
‚Wirtschaftskrisen‘ als Zukunftskrisen und Arbeitslosenzahlen als Leitkriterium
Im Frühjahr und Frühsommer 2020 etablierte sich zügig ein Begriffsnetz um ‚Corona-Krise‘, ‚Corona-Pandemie‘ und die Wendung ‚coronabedingt‘. Rasch dockten an dieses Netz Warnungen vor den wirtschaftlichen Konsequenzen der Infektionsschutzmaßnahmen an, ohne dass ‚Corona‘ – zur Metonymie für verschiedene Auswirkungen der Pandemie geworden – bis heute (Januar 2021) in Deutschland eindeutig als ‚Wirtschaftskrise‘ firmieren würde. Dieser Befund markiert einerseits ein Spezifikum der gegenwärtigen Krise, bestätigt andererseits bekannte Muster.
Ein Spezifikum der aktuellen Krise liegt in ihren sehr eigenen Wiederholungsstrukturen. Die Abhängigkeit von der schwankenden Verbreitung des Virus, sprachlich vermittelt durch die ‚Wellen‘-Metapher, ruft eine untypische Rhythmik der Krise hervor. Dabei wiederholen sich Szenarien (Verschärfungen und Lockerungen von Maßnahmen) nicht im Detail, aber in der Grundstruktur. Hier zeigt sich die Besonderheit einer Krise, deren Verlauf fortgesetzt von einem exogenen medizinischen Faktor mit-beeinflusst wird. Anders als bei früheren großen Krisen folgen weniger trennscharf verschiedene Teilkrisen aufeinander, etwa eine Struktur-, eine Finanz- oder eine politische Krise, die sich zu einer umfänglichen ‚Wirtschaftskrise‘ fortentwickeln. Es bleibt abzuwarten, inwiefern sich dies ändert, sobald das Infektionsgeschehen nachhaltig nachlässt, Folgeeffekte der Infektionsschutzmaßnahmen aber vorerst bestehen bleiben und in den Debattenmittelpunkt rücken.
Typische Merkmale einer ‚Wirtschaftskrise‘ offenbart der Krisenverlauf in Deutschland gleichwohl. Denn ‚Wirtschaftskrisen‘ sind zunächst Zukunftskrisen. Stark irritierte oder getrübte Erwartungen, nicht bereits eingetretene materielle Problemlagen, etwa horrend steigende Zahlen an Insolvenzen, lassen die Rede von einer (drohenden) ‚Wirtschaftskrise‘ aufkommen. Besonders prägnant war dies in den 1970er Jahren zu beobachten: Im Zuge des Ölpreisschocks verstetigte sich ab Ende 1973 die Diagnose einer ‚Wirtschaftskrise‘, obwohl die Wirtschaft bis in die zweite Jahreshälfte 1974 noch wuchs und eine tiefe Rezession das Land erst 1975 erschütterte. Warnungen vor möglichen künftigen Gefahren für die volkswirtschaftliche Entwicklung gehören zu ‚Wirtschaftskrisen‘ also genauso elementar wie (spätere) realwirtschaftliche Turbulenzen, die sich wirtschaftsstatistisch niederschlagen. Zugleich dienen diese Warnungen im Idealfall dazu, frühzeitig abfedernde Maßnahmen, z.B. die Ausweitung von Kurzarbeitsregeln, einzufordern und politisch durchzusetzen. Hier bestätigt die Corona-Krise bekannte Krisenmuster, zumal Meldungen über massive wirtschaftliche Einbrüche in Nachbarländern vor Augen führen, wie real die volkswirtschaftlichen Gefahren sind.
Dass Deutschland dennoch bislang rhetorisch nicht flächendeckend in einer tiefen ‚Wirtschaftskrise‘ steckt, hängt mit einem zweiten Faktor zusammen: dem vorherrschenden Maßstab, der im politisch-medialen Diskurs beeinflusst, wie ‚krisenbehaftet‘ die Wirtschaft dasteht – den Arbeitslosenzahlen. In politischen Debatten sind sie entscheidender als die Kategorie des Wachstums. Ein Umschwung zu einer positiven Arbeitsmarktentwicklung kann eine ‚Wirtschaftskrise‘ entschärfen, obwohl die Wachstumsentwicklung noch negativ ist – so beispielsweise 1967 geschehen. Eine ähnliche Tendenz zeigte sich auch 2020: Zwar stieg die Arbeitslosenzahl im Jahresmittel erstmals seit sieben Jahren. Der Anstieg um 429.000 Arbeitslose fiel angesichts eines Schrumpfens des Bruttoinlandsprodukts um 5 Prozent jedoch moderater als befürchtet aus; im Dezember ging die Arbeitslosenzahl saisonbereinigt sogar zurück.[11] Kurzum: Wenn Wachstumseinbrüche nicht in voller Härte auf den Arbeitsmarkt durchschlagen, setzt sich in der politischen Kommunikation die Deutung einer ‚Wirtschaftskrise‘ nicht dauerhaft fest. Das zumindest lehrt der langfristige Krisenvergleich. Die Entwicklung der kommenden Monate wird zeigen, ob dieses Muster in der politischen Kommunikation Bestand behält – und welche Art von ‚Krise‘ als letzte zu überwinden sein wird.
[1] Einfache Anführungszeichen werden verwendet, um anzuzeigen, dass ein politisches Deutungsmuster gemeint ist oder ein Begriff thematisiert wird.
[2] Vgl. Reinhart Koselleck, Art. Krise, in: Ders. / Otto Brunner / Werner Conze (Hg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Bd. 3, Stuttgart 1982, S. 617–650, hier S. 641.
[3] Zur parallelen Popularität des Krisenbegriffs auch in der Historiografie siehe Rüdiger Graf / Konrad H. Jarausch, „Crisis“ in Contemporary History and Historiography, Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 27.3.2017.
[4] Derartige Muster haben mehrere vergleichende Studien aus den Geschichts- und Sprachwissenschaften, auf deren Ergebnissen dieser Beitrag aufbaut, in den vergangenen Jahren herausgearbeitet, siehe insbesondere: Martin Wengeler / Alexander Ziem, Wie über Krisen geredet wird. Einige Ergebnisse eines diskursgeschichtlichen Forschungsprojekts, in: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 173/2014, S. 52–74; David Römer, Wirtschaftskrisen. Eine linguistische Diskursgeschichte, Berlin 2017; Kristoffer Klammer, ‚Wirtschaftskrisen‘. Effekt und Faktor politischer Kommunikation. Deutschland 1929–1976, Göttingen 2019.
[5] Varianten der Intervention von Historiker*innen in der ‚Corona-Krise‘ reflektierte jüngst Margrit Pernau, Aus der Geschichte lernen? Die Rolle der Historiker:innen in der Krise, in: Geschichte und Gesellschaft 46/3 (2020), S. 563–574.
[6] Fernsehansprache von Bundeskanzlerin Angela Merkel am 18. März 2020, [S. 1], [19.01.2021]. Eigene Hervorhebung.
[7] Ebd., [S. 6]. Eigene Hervorhebung.
[8] ‚Topos‘ und ‚Rede-‘ bzw. ‚Sprachmuster‘ verwende ich hier synonym.
[9] Vgl.: Klammer, ‚Wirtschaftskrisen‘, S. 443; Martin Wengeler, „Noch nie zuvor“. Zur sprachlichen Konstruktion der Wirtschaftskrise 2008/09 im SPIEGEL, in: Aptum. Zeitschrift für Sprachkritik und Sprachkultur 2/2010, S. 138–156, hier S. 148, 155; Ders., Die Analyse von Argumentationsmustern als Beitrag zur „transtextuell orientierten Linguistik“, in: Heidrun Kämper / Ingo H. Warnke (Hg.), Diskurs – interdisziplinär. Zugänge, Gegenstände, Perspektiven, Berlin 2015, S. 47–62, hier S. 54.
[10] Vgl. [Deutschlandtrend] Großes Vertrauen in Merkel & Co., 02.04.2020, [21.01.2021]. Infratest-dimap ermittelte, dass 72 Prozent der Befragten mit dem „Corona-Krisenmanagement“ der Bundesregierung „zufrieden oder sehr zufrieden“ seien.
[11] Vgl.: [Arbeitsmarkt] Zahl der Arbeitslosen steigt im Dezember leicht an, 05.01.2021, Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 020 vom 14.01.2021, [21.01.2021].
Zitation
Kristoffer Klammer, (Wirtschafts-)Krisen als politische Kommunikation. Über wiederkehrende Muster zahlreicher Krisen zwischen Schwarzem Donnerstag und Corona-Pandemie , in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://dev.zeitgeschichte-online.de/index.php/kommentar/wirtschafts-krisen-als-politische-kommunikation