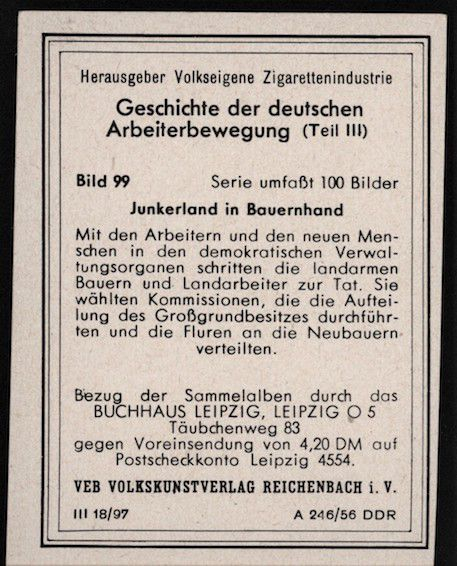*Der Beitrag ist in gekürzter Form auch im Begleitkatalog zu der Sonderausstellung "1870/71. Reichsgründung in Versailles" der Otto-von-Bismarck-Stiftung in Friedrichsruh erschienen (Die DDR und die Reichsgründung, in: Ulrich Lappenküper/Maik Ohnezeit (Hrsg.), 1870/71. Reichsgründung in Versailles, Friedrichsruh 2021, S. 200-205). Hier der digitale Rundgang durch die Ausstellung.
"Mit der Vergangenheit brechen" und sich "einen neuen Weg, einen Weg zum Glück des ganzen Volkes bahnen" – nicht mehr und nicht weniger hatte sich der Nationalrat der Nationalen Front der DDR in einem Grundsatzpapier aus dem Jahr 1962 vorgenommen.[1] Um zu wissen, womit konkret gebrochen werden sollte, musste die Vergangenheit über das Dritte Reich hinaus zurück bis ins 19. Jahrhundert erforscht werden. Von entscheidender Bedeutung war dabei die Geschichte der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung, deren Entstehung in das 1871 gegründete Deutsche Kaiserreich fiel.
Parteiideologen reduzierten den monarchischen Bundesstaat auf die obrigkeitsstaatliche Unterdrückung breiter Bevölkerungsteile. Gepaart mit Schreckensbildern von Militarismus, Imperialismus, dem Einfluss von Kirchen und anderen Gegnern der sozialistischen Zukunftsvision, konnte das Deutsche Reich als letztes Aufbäumen des Feudalismus an der Schwelle der Moderne als eine Vorgeschichte des Nationalsozialismus gedeutet werden. Zumindest legte dies jene aus dem Œuvre von Karl Marx abgeleitete Teleologie von Gesellschaftsordnungen nahe, an der trotz gelegentlicher Variationen über vier Jahrzehnte festgehalten wurde: Absolutismus – Kapitalismus – Imperialismus – Revolution und Zusammenbruch – Sozialismus – Kommunismus.
Geerbte Bühnenbilder: Sozialismus vor monarchischen Kulissen
Im Kreis ihrer sozialistischen „Bruderstaaten“ erklomm die DDR in der ehrgeizigen Eigenwahrnehmung sukzessive die letzten beiden Stufen. Aber diese Entwicklung vollzog sich nicht im luftleeren Raum, sondern vor den architektonischen und geistigen Kulissen des überwundenen preußischen Erbes, aus dessen ambivalentem Gesamtpaket man sich auf breiter Front die Rosinen pickte. Diese Versatzstücke wurden zu einer Integrationserzählung verbunden, die spätestens seit Beginn der Ära Honecker von einem eigenständigen Nationalstaat zwischen Ostsee und Thüringer Wald handelte.
Allerdings entfaltete diese Legende trotz aller Propagandaanstrengungen nicht die erhoffte Wirkung. Nach dem Fall der Mauer stellten die Bürger:innen die Wirkungslosigkeit der Rhetorik von der „sozialistischen Nation“ unter Beweis. Sie wollten nach einer geglückten Revolution mehrheitlich in jenen gemeinsamen Nationalstaat zurückkehren, den deutsche Fürsten 1871 gegründet und den die Deutschen schon einmal, nach dem Ende der Monarchie 1918, als gemeinsame Hülle erhalten hatten.
Abrisse und Enteignungen: „Junkerland in Bauernhand“
Diese Beharrungskräfte sind erstaunlich, wenn man sich vor Augen führt, mit welcher Vehemenz die kommunistischen Machthaber schon vor der Gründung der DDR ans Werk gegangen waren. In der Bodenreform der Jahre 1945 bis 1948 wurden die zu Symbolen des überkommenen Systems stilisierten Großgrundbesitzer enteignet – jene in der Mehrheit adeligen Stützen der konservativen ländlichen Ordnung Ostelbiens, auf deren politische Verlässlichkeit das allgemeine Männerwahlrecht Bismarcks einst gebaut hatte. „Junkerland in Bauernhand“ lautete die einprägsame Parole. Als Relikte der Monarchie wurden die baulich sichtbaren Zeichen der traditionellen Grundherrschaften ebenso zum Ziel von Bilderstürmen wie die Denkmäler für Könige und Fürsten. Innerhalb kürzester Zeit wurden Symbolgestalten des Kaiserreichs von Straßenschildern getilgt, allen voran der zuvor von nationalprotestantischen Kreisen als Integrationsfigur mythisch verehrte Bismarck. Seine vorherige Omnipräsenz im öffentlichen Raum wich einem neuen Ehrregime für seine vermeintlichen und tatsächlichen Widersacher Marx, Engels, Bebel, Liebknecht, Luxemburg, Lenin, Thälmann und – anfangs – Stalin.[2]
Das Verschwinden Preußens durch das Kontrollratsgesetz Nr. 46 vom 25. Februar 1947 ("seit jeher Träger des Militarismus und der Reaktion in Deutschland") wurde in allen vier alliierten Besatzungszonen mehr oder weniger lakonisch zur Kenntnis genommen – die Zusammenbruchgesellschaft hatte andere Probleme. In der sowjetischen Besatzungszone ging man noch einen Schritt weiter, indem man 1952 die alten und neugebildeten Länder (Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg) de facto auflöste. Damit verschwand jenes föderale Band, das seit 1871 die überkommenen Standesherrschaften im Bundesrat zusammengeführt und maßgeblich zur Verfassungsordnung des Kaiserreichs beigetragen hatte.[3] An seine Stelle trat der sogenannte „Demokratische Zentralismus“ nach sowjetischem Vorbild der Rajons, mit dem die Staatsführung bereits in der Ära Ulbricht ungestört von regionalen Zuständigkeiten in 14 Bezirken durchregieren konnte.
Berlin: Die alte „Reichhauptstadt“ als „Hauptstadt der DDR“
Ein anderes Relikt der Bismarckschen Staatsgründung überlebte dagegen nicht nur nach den Buchstaben des Verfassungstextes, sondern auch in der Verfassungswirklichkeit: Die zur „Hauptstadt der DDR“ umetikettierte „Reichshauptstadt“ Berlin (1949 in Artikel 2, 1968 und 1974 je in Artikel 1). Bis zum Überdruss der Bürger:innen in den übrigen Teilen des Landes wurden die elf östlichen Stadtbezirke des ehemaligen Großberlin bei Wiederaufbau, Gehältern, Konsumgüter- und Nahrungsmittelversorgung bevorzugt. Was der Ehrgeiz der Planer beim Aufbau der sozialistischen Gesellschaft hier an Ressourcen band, fehlte andernorts. Das sorgte trotz propagandistischer Dauerbeschallung im Rest der DDR sogar für eine gegen Berlin formulierte Festigung regionaler Identitäten. Vor allem im wirtschaftlich traditionell starken und nun zunehmend von der Hauptstadt in den Schatten gestellten Süden konnten diese Divergenzen an alte Erzählungen im kollektiven Gedächtnis anknüpfen: Die einstige Konkurrenz der mitteldeutschen Staaten und ihrer Dynastien mit dem von der „Verreichlichung“ des Kaiserreichs profitierenden Berlin der Hohenzollern schimmerte nun eher als Fortschreibung des zentralisierenden Dritten Reiches denn als visionärer Aufbruch in eine sozialistisch gleiche Gesellschaft durch den Alltag des Arbeiter- und Bauernstaates hindurch.[4]
Barock und Beton: Identitätsstiftendes Bauen für den Sozialismus
Der 1893 in das sozialdemokratische Arbeitermilieu Leipzigs geborene erste Parteichef Walter Ulbricht tat sich bei der als prioritär eingestuften, sozialistischen Umgestaltung Berlins als wenig zimperlicher Stadtplaner hervor. Mit dem Abriss des im Krieg ausgebrannten und zunächst für den Wiederaufbau vorgesehenen Berliner Schlosses tilgte er 1950 ein Symbol der Hohenzollern, deren letzte drei Herrscher als Deutsche Kaiser den aus dem Spätmittelalter stammenden Sitz der Familie mit dem 1871 gegründeten Kaiserreich verschmolzen. Es war nur konsequent, wenn 1958 die Sprengung des Geburtshauses des ersten Reichskanzlers in Schönhausen in der Altmark folgte. Schließlich stand Bismarck für die Gründung des deutschen Nationalstaats. Marx und Engels begrüßten zwar die Einigung, allerdings verfolgte Bismarck dann die sozialistische Arbeiterschaft politisch, was die Sozialisation von SED-Genossen aus der Alterskohorte Ulbrichts noch spürbar geprägt hatte.[5]
Wenn diese Symbole fielen, was folgte ihnen? Vereinfacht gesagt, entstand eine eigentümliche, begehbare Geschichtslandschaft, in deren Mischung architektonische Relikte des 19. Jahrhunderts neben städtebaulichen Betonvisionen standen, da Ost und West in der Ära des Machbarkeitsglaubens und der Technikfaszination stadtplanerisch weniger trennte als politisch. Und auch politisch-ideologisch floss – grob gezeichnet – eine Emulsion aus Versatzstücken von „progressivem Erbe“ und revolutionär autorisiertem, historischem Materialismus zusammen. Dabei okkupierte die „Kulturnation“ DDR die frühe deutsche Nationalbewegung und pickte sich mit dem Freiherrn vom Stein, dem Wartburgfest, dem Turnvater Jahn oder der 1848-er-Revolution Personen und Ereignisse heraus, die in ihre Ideologie passten.[6]
Vorbilder für 20 Pfennig: Geschichtsbilder auf Briefmarken
Ein Blick auf die in Schule und Populärkultur verbreitete Ikonografie des 19. Jahrhunderts ist am direktesten möglich, wenn man einen Briefmarkenkatalog der Deutschen Post der DDR aufschlägt. Neben den erwähnten Persönlichkeiten finden sich u.a. die beiden Humboldts und aus dem Kaiserreich die Wissenschaftler Theodor Mommsen, Rudolf Virchow oder Hermann von Helmholtz sowie (auch ohne anlassgebende Jahrestage) immer wieder Karl Marx, Friedrich Engels, Franz Mehring, August Bebel, Wilhelm und Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg und Clara Zetkin als Motive.
Die Reichsgründung sucht man vergebens, wogegen das Ende des Kaiserreichs nicht übersehen wurde: 40 Jahre Novemberrevolution waren der DDR 1958 eine Briefmarke im Wert von 20 Pfennig Briefporto wert.[7] Dreizehn Jahre später, im 22. Jahr der deutschen Teilung, jährte sich die Reichsgründung zum 100. Mal. Was in der Bundesrepublik Anlass zu unterschiedlichen Einlassungen war[8], wurde in der DDR einheitlich negativ bewertet: Die monarchische Nationalstaatsgründung überging man konsequent. Stattdessen wurden 1971 vier Sondermarken in Erinnerung an den 100. Jahrestag der Pariser Commune veröffentlicht – eine Rückprojektion der sozialistischen Internationale für den deutschen demokratischen Postverkehr.
Totgesagte leben länger: „Preußen-Renaissance“ und „Tradition-und-Erbe“-Debatte
Ob diese Deutungen verfingen, ist schwer zu bestimmen. An das Langzeitgedächtnis anknüpfungsfähig waren die auch in der DDR sichtbaren Zeichen der in der Bundesrepublik gegen Ende der 1970er Jahre entstehenden Preußen-Renaissance.[9] In souveräner Selbstüberschätzung der Akzeptanz einer eigenen nationalen Identität durch die DDR-Bürger scheuten Partei- und Staatsführung gewisse Insignien des preußischen Erbes weniger als ihre Vorgänger in den beiden ersten Nachkriegsjahrzehnten. Der Staat der Hohenzollern trat in Ost-Berlin am augenfälligsten in dem 1950 abgeräumten Reiterstandbilds Friedrichs II. Unter den Linden in Erscheinung, das 1980 wieder aufgestellt wurde und zum Berliner 750. Stadtjubiläum 1987 selbstbewusst an die einstige Herrscherdynastie erinnerte – mit ausdrücklichem Plazet Erich Honeckers, der sich hier von seinem Vorgänger Ulbricht deutlich absetzte.[10] Allerdings blieben solche symbolischen Akte singuläre Ereignisse und oblagen strenger staatlicher Planung und Überwachung. Gedenkfeiern waren wie alle öffentlichen Veranstaltungen ohnehin genehmigungspflichtig, weshalb es keine sichtbaren Erinnerungsrituale für die Reichsgründung gab. Das bedeutet nicht, dass es auf lokaler und regionaler Ebene keine sichtbaren Erinnerungen an Personen und Ereignisse aus der Zeit des Kaiserreichs gab – über Geburtstage, Jubiläen oder das breite Feld der Denkmalpflege waren Elemente des ersten deutschen Nationalstaats (wenn auch nicht seine Gründung) stets auch Teil des Heimatdiskurses der „sozialistischen Nation“.[11]
Diese leichten Annäherungen an die monarchischen Vorgängerstaaten (in Dresden wurde 1985 die wiederaufgebaute Semperoper eröffnet) sind nicht zu verstehen ohne die Veränderungen der historisch-politischen Doktrin. Parteiinstitute, Universitäts- und Akademiewissenschaft übten sich über vierzig Jahre in der Quadratur des Kreises beim Versöhnen des eigenen Daseins als Speerspitze des sozialistischen Menschheitsfortschritts mit den humanistischen und klassizistischen Traditionen der deutschen Geschichte.[12] Die Schwierigkeit lag darin, in die auf Bertolt Brecht und Johannes R. Becher zulaufende, lineare Erzählung von Lessing, Goethe, Schiller, Fontane und Thomas Mann irgendwo die Monarchen und deren Staatsmänner einzupassen. In Publizistik und Wissenschaft gab es bei dieser Sinnsuche kein einheitliches Bild. Zwar war bereits 1946 durch den einstigen KPD-Kulturfunktionär Alexander Abusch die seitdem gelegentlich variierte Parole vorgegeben, wonach Preußen ein „Staat der Junker“ und Bismarck ein „Diktator“ gewesen seien.[13] Aber eine in ihrer unveränderlichen Grundrichtung wieder und wieder monoton abgeschrittene Linie gab es nur bei diesen Schlagworten und den marxistischen Großerzählungen von Klassenkampf, Monopolkapitalismus und dem Sieg des Sozialismus.
Wandel durch Annäherung? "Deutsche Geschichte“ aus ostdeutscher Perspektive
Noch Ende der 1980er Jahre fanden sich diese Lesarten in den Bänden 4 und 5 der auf zwölf Bände angelegten „Deutsche[n] Geschichte“, die im Ost-Berliner „Deutschen Verlag der Wissenschaft“ und dem maßgeblich von der DDR finanzierten Verlag „Pahl-Rugenstein“ in Köln erschienen.[14] Aber dort klangen auch Zwischentöne an, die, wenngleich teleologisch auf den sozialistisch-kommunistischen Fluchtpunkt zulaufend, der Reichsgründung durch Bismarck unfreiwillig positive Seiten abgewinnen konnten: Zwar sei die Kaiserproklamation „ein denkwürdiges Symbol für den volksfremden, monarchistisch-militaristischen Charakter und die reaktionäre Klassengrundlage des preußisch-deutschen Staates, der in einem Eroberungskrieg gegen das französische Nachbarvolk aus der Taufe gehoben wurde“, gewesen. Aber: „Nunmehr herrschten in Deutschland die kapitalistischen Produktionsverhältnisse; ein geschlossenes Wirtschaftsgebiet und ein nationaler Binnenmarkt waren entstanden. […] Die Entstehung des bürgerlichen Nationalstaats beendete die Möglichkeit der Einmischung ausländischer Mächte in deutsche Belange und schuf das einheitliche Kampffeld, auf dem die Klassenkämpfe der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft frei von partikularistischen Fesseln ausgetragen werden konnten.“[15]
Und als fast schon überschwängliches Lob für den „Nestor der marxistisch-leninistischen Bismarck-Forschung in der DDR“, Ernst Engelberg[16], schrieb Heinz Wolter 1985 über dessen damals eben erschienenen ersten Band seiner Bismarck-Biographie, darin werde „ein breites Spektrum der Klassenkämpfe, der innen- und außenpolitischen Auseinandersetzungen in der Epoche der bürgerlichen Umwälzung geboten, doch inmitten bleibt Bismarck, der ‚Urpreuße und Reichsgründer‘, dabei immer eine Gestalt von Fleisch und Blut, die ihre Faszination ausübt.“[17]
Konnte sich hier eine nüchterne, wenn auch späte Interpretation der Reichsgründung durchsetzen, wie sie Engelberg am Ende seiner Darstellung offen formulierte, wenn er schrieb: „Noch war ja nicht entschieden, ob die nationalstaatliche Einigung von 1871 durch eine demokratische Umgestaltung ergänzt und dadurch mit neuem Inhalt erfüllt werden könnte“, und wie sie sich in einem zaghaften Abbau von antipreußischen Ressentiments wie der Wiederaufstellung des Denkmals Friedrichs II. zeigten?[18] Wohl kaum, darf man getrost vermuten. Zu eingefahren waren die ideologischen Bahnen in Ministerien und Verwaltungen, in Universitäten, Schulen, politischer Agitation in Betrieben und in der Presse. Bis zur Abstimmung mit den Füßen im Sommer und Herbst 1989 blieb eine Neubewertung der Vorgeschichte der „sozialistischen Nation“ im 19. Jahrhundert ein auf Teile der politischen Funktionseliten und der historischen Wissenschafts- und Vermittlungsarbeit in Universitäten, Kulturhäusern und Heimatvereinen beschränktes Thema – in der Bevölkerung spielten ganz andere Deutungen der 1871 begründeten nationalstaatlichen Geschichte eine Rolle, wie die Monate von November 1989 bis Oktober 1990 zeigten.
[1] Die geschichtliche Aufgabe der Deutschen Demokratischen Republik und die Zukunft Deutschlands, in: Das Nationale Dokument, Schriftenreihe des Staatsrats der Deutschen Demokratischen Republik, Nr. 3, Berlin 1963, S. 21.
[2] Ulf Morgenstern/Christian Wachter, Wie der Bismarck-Mythos in die Landschaft kam. Bismarck-Ehrungen im öffentlichen Raum: Entstehung, Kartierung und Interpretationsansätze, in: Dietmar von Reeken/Malte Thießen (Hrsg.), Ehrregime. Akteure, Praktiken und Medien lokaler Ehrungen in der Moderne, Göttingen 2016, S. 89-112.
[3] Vgl. zuletzt grundlegend Oliver F. R. Haardt, Bismarcks ewiger Bund. Eine neue Geschichte des Deutschen Kaiserreichs, Darmstadt 2020.
[4] Ulf Morgenstern, Sächsische (Dis-)Kontinuitäten und die „Sachsenrenaissance“. Von Verschwinden und Wiederkehr Sachsens in den vier Jahrzehnten der DDR, in: Konstantin Hermann (Hrsg.), Sachsen seit der Friedlichen Revolution. Tradition, Wandel, Perspektiven, Beucha 2010, S. 28-45.
[5] S. zu dieser frühen Phase Ilko-Sascha Kowalczuk, Legitimation eines neuen Staats. Parteiarbeiter an der historischen Front. Geschichtswissenschaft in der SBZ/DDR 1945 bis 1961. Berlin 1997.
[6] „Von der Geschichte, der Kultur und der Sprache werden wir nichts preisgeben, was es an Positivem zu erhalten und zu pflegen gibt, was humanistischen und den revolutionären Traditionen entspricht.“ Erich Honecker, Reden und Aufsätze, Bd. 2, Berlin 1975, S. 241.
[7] Allerdings wurde dieses Postwertzeichen noch am Ausgabetag wieder eingezogen, denn bei genauer Betrachtung schien ein Arbeiter mit Gewehr aus dem Hintergrund auf einen NVA-Soldaten mit asiatischen Gesichtszügen im Vordergrund zu zielen: Die vom Volksmund „Pappchinese“ genannte Marke wurde stillschweigend vom Markt genommen.
[8] Vgl. dazu Sebastian Schubert, Abschied vom Nationalstaat? Die deutsche Reichsgründung 1871 in der Geschichtspolitik des geteilten Deutschlands von 1965 bis 1974, in: Heinrich August Winkler (Hrsg.), Griff nach der Deutungsmacht. Zur Geschichte der Geschichtspolitik in Deutschland, Göttingen 2004, S. 230-265; Ulrich Lappenküper, Vom Umgang mit der Reichsgründung in der deutschen Geschichte nach 1871, in: Andreas Braune u.a. (Hrsg.), Einigkeit und Recht – doch Freiheit? Das Kaiserreich in der deutschen Demokratiegeschichte, Weimar 2020, S.116-121.
[9] Vgl. dazu zuletzt Bärbel Holtz, Das Thema Preußen in Wissenschaft und Wissenschaftspolitik der DDR, in: Wolfgang Neugebauer (Hrsg.), Das Thema „Preußen“ in Wissenschaft und Wissenschaftspolitik des 19. und 20. Jahrhunderts. Berlin 2006, S. 329-354; sowie Daniel Benedikt Stienen, Wie aus Friedrich „dem Zweiten“ wieder Friedrich „der Große“ wurde – oder auch nicht. Zur „Preußen-Renaissance“ in der DDR, in: Berliner Debatte Initial 32 (2021), S. 48-60.
[10] Helmut Engel, „Auferstanden aus Ruinen“. Aneignung einer Geschichtslandschaft in der DDR, in: Ders./Wolfgang Ribbe (Hrsg.), Via triumphalis. Geschichtslandschaft „Unter den Linden“ zwischen Friedrich-Denkmal und Schloßbrücke, Berlin 1997, S. 91-128.
[11] Vgl. dazu Jan Palmowski, Die Erfindung der Sozialistischen Nation. Heimat und Politik im DDR-Alltag, Berlin 2016.
[12] Vgl. Horst Bartel/Walter Schmidt, Historisches Erbe und Traditionen. Bilanz, Probleme, Konsequenzen, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 30 (1982), S. 816-829.
[13] Alexander Abusch, Der Irrweg einer Nation. Ein Beitrag zum Verständnis deutscher Geschichte Berlin 1946 (zuerst Mexico „El Libro libre“ 1945), S. 41 u. 112.
[14] [Autorengruppe unter der Leitung von Walter Schmidt], Deutsche Geschichte. Bd. 4: Die bürgerliche Umwälzung von 1789 bis 1971, Köln 1984, [Autorenkollektiv unter der Leitung von Gustav Seeber], Deutsche Geschichte. Bd. 5: Kapitalismus und Übergang zum Monopolkapitalismus, Berlin 1988.
[15] Deutsche Geschichte. Bd. 4, S. 508f.
[16] Engelbergs zweibändige, jeweils zeitgleich im Ost-Berliner Akademie-Verlag wie im West-Berliner Siedler-Verlag erschienene Bismarck-Biographie ist noch immer ein Standardwerk. Ernst Engelberg, Bismarck. Urpreuße und Reichsgründer, Berlin 1985; Ders., Bismarck. Das Reich in der Mitte Europas, Berlin 1990.
[17] Heinz Wolter, Einleitung zu: Otto von Bismarck. Dokumente seines Lebens, Leipzig 1986, S. 25 f.
[18] Ernst Engelberg, Bismarck. Urpreuße und Reichsgründer, Berlin 1985, S. 762.
Zitation
Ulf Morgenstern, Eine schwierige Geschichte. Über den Ort der Reichsgründung in der Identitätssuche der DDR* , in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://dev.zeitgeschichte-online.de/geschichtskultur/eine-schwierige-geschichte